Datum:
23. September 2025
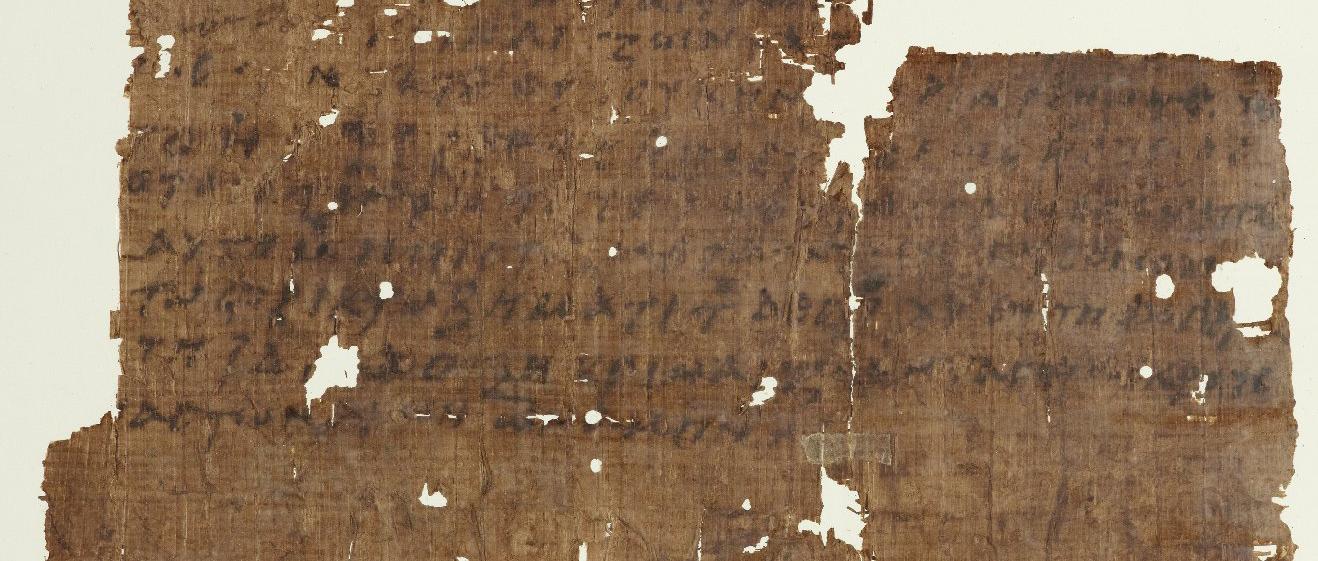
Die Abende, die alle in Bonn stattfinden, haben diese gleichbleibende Struktur:
19.00–20.30 Uhr Vortrag und Diskussion
20.30–21.15 Uhr Austausch bei Wasser, Wein und Salzigem
Um die Abende planen zu können, bitten wir um digitale Anmeldung über den Link im QR-Code oder durch eine Mail an info@bildungswerk-bonn.de. Gerne können Sie aber auch spontan kommen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wir bitten am
Ende des Abends um eine finanzielle Unterstützung.
Kontakt und weitere Informationen
Katholisches Bildungsforum Bonn
Karin Dierkes
Telefon 0228 42979-128
dierkes@bildungsforum-bonn.de
Di 25.11.2025
Das ökumenische Bekenntnis erschließen
Agnes Steinmetz und Kerstin Schulz-Ahrens
Ort: Evangelischer Kirchenpavillon | Kaiserplatz 1a | Bonn